Die Hauptfigur aus Thomas Manns Roman Dr. Faustus, der Komponist Adrian Leverkühn, soll derjenige sein, der die deutsche musikalische Kulturlandschaft mit der Idee der Zwölftonmusik erschüttern und umwandeln wird. Die Beschaffenheit seines außergewöhnlichen Charakters leitet den Musiker zu der geschichtsträchtigen Entscheidung, die er schließlich sogar mit dem leibhaftigen „Deubel“, dem Herrn „Dicis et non facis“ in einem schrecklichen Handel zur Bedingung erhebt, auf der Basis eines Liebesverbots (Kapitel XXV). Mann schaffte sich seine ganz eigene Vorstellung von den Charaktereigenschaften eines solchen Umstürzlers und eckte damit gewaltig an die Interessen einer Person an: Niemand anderer als Arnold Schönberg, der selbsternannte Erfinder der Dodekaphonie, fühlte sich schwer beleidigt von der Romanfigur.
Schönbergs Tochter Nuria erklärt im SZ-Interview den Hergang dieses schlimmen Zerwürfnisses:
„Mann hat sich in den USA hinter seinem Rücken von Theodor Adorno die Methode der Zwölftonkomposition erklären lassen für seinen Doktor Faustus, Adorno war ja nicht nur Philosoph, sondern auch Musiktheoretiker. Er hat sie für sich selbst erfunden, aber nicht, weil er wie Leverkühn etwa Syphilis hatte oder verrückt war oder das Ende der deutschen Kultur repräsentierte.“1
Das muss man sich verdeutlichen: Den Erfinder der Zwölftonmusik als verrückten Syphilitiker hinzustellen, der die absolute Vorherrschaft der Zwölftonmusik in einem Teufelspakt beschließt – das ist in der Tat ein starkes Stück. Der Vorwurf, Thomas Mann habe Schönberg als Vollstrecker des Niedergangs der deutschen Kultur gebrandmarkt ist dennoch höchst diskutabel. Aus heutiger Sicht erscheint es viel mehr so, als habe Thomas Mann die Folgen einer solchen Kompositionsweise, die gesellschaftlichen und persönlichen Konsequenzen für einen Schreiberling solcher Musik in weisester Voraussicht prophezeit.
Der fiktive Adrian Leverkühn ist in seiner ganzen Person, in seinen charakterlichen Eigenschaften, in seiner Bedeutung für die Musikwelt, in seinen sozialen Bindungen das Sinnbild des modernen Komponisten bis heute! Thomas Mann hat in dieser Person viel mehr verwirklicht als nur ein Portrait des selbst ernannten Erfinders der Zwölftonmusik Arnold Schönberg, es ist ein in die Zukunft weisendes Bildnis, das um so mehr an Schärfe gewinnt, je stärker Thomas Mann es gegen die früheren Komponistenbiographien, die alten Meister der Musik, antreten lässt.
Was hat es also mit diesem Leverkühn genau auf sich?
Der künstlerische Werdegang sticht zuvörderst ins Auge: Zur Musik nicht von Anfang an bestellt, wendet sich der blitzgescheite, aber im menschlichen Umgang kühle und distanzierte junge Mann der Theologie zu, eine etwaige Anspielung auf die ersten Zeilen von Goethes Faust:
„Habe nun, ach, Philosophie,
Juristerei und Medizin
Und leider auch Theologie!
Durchaus studiert mit heißem Bemühn.“
Wir haben es also mit einem Menschen zu tun, der sich nicht von Anfang an zur Tonkunst berufen fühlt. Adrian Leverkühn kann sich deshalb so schwer zum Beruf des Musikers durchringen, weil ihm ein Platz in der Musikwelt mit seinem Charakter unvereinbar erscheint. Er hegt beispielsweise eine tiefe Abneigung gegen das Spielen vor dem Publikum, gegen die Interpretation vor Menschen, deren vorrangigen Zweck er als oberflächliche Zurschaustellung des Künstler-Egos, besonders in der Person des Dirigenten scharf verurteilt.
Welch ein Unterschied gegenüber den Komponisten von der Renaissance an bis hin zur Spätromantik ist in dieser Eigenschaft ausgesprochen, welche nahezu ohne Ausnahme entweder die Funktion eines begnadeten Virtuosen oder Kapellmeisters verkörperten. Der Typus des Komponisten, der niemals herausragende interpretatorische Aktivitäten gezeigt hat, war zu Thomas Manns Zeiten ein Novum, auch wenn dieser heute im deutschsprachigen Raum nahezu selbstverständlich erscheint.
Man vergleiche zum Beispiel die (heutige) Situation am Moskauer Konservatorium mit den Verhältnissen in Deutschland und Österreich: Dort werden nur Studenten zum Kompositionsstudium zugelassen, die bereits für ein Konzertfachstudium inskribiert sind, hier sind es lediglich „die Bravsten der Tonsatzjugend“2, will sagen die hörigen Streber.
Eine kurze historische Rückschau soll an die interpretatorischen Ambitionen der Genies erinnern (den ehrenden Titel, den der Erzähler Zeitblom seinem Freund Lerverkühn bedenkenlos gönnt, worin natürlich einige Ironie liegt). Beethoven spielte als Jugendlicher die Orgel, im Bonner Orchester die Viola, trat außerdem als Klaviervirtuose unter anderem mit seinen eigenen Werken auf und leitete sogar bis zur Schwerhörigkeit Orchesterkonzerte. Wagner erlernte kein Instrument bis zur Meisterschaft, sammelte aber bereits in jungen Jahren Erfahrung im Dirigieren, arbeitete sich zum Kapellmeister empor und begründete letztendlich die Funktion, Rolle und Technik des modernen Dirigenten, wie sie sich bis zum heutigen Tag erhalten hat. Händel, Vivaldi, Buxtehude, Bach – waren allesamt hervorragende Virtuosen auf ihrem Instrument, Mozart spielte sogar auf dem Klavier und der Violine seine eigenen Solokonzerte. Was das „Genie“ Leverkühn betrifft, steht er schon in diesem ersten Punkt ganz abseits in der Geschichte europäischer Kunstmusik.
Nach langjährigen Erwägungen und mit der wachsenden Erkenntnis, dass das Theologiestudium für seinen Lebensweg eigentlich nur eine Ausflucht gewesen war, entschließt sich Adrian Leverkühn doch noch zur Komposition. Ihm sind seine eigenen Mängel, seine völlig veränderte Stellung gegenüber der herrschenden Musikkultur durchaus bewusst.
Die Erkenntnis und Formulierung dieser Stolpersteine auf seinem Weg sind vom damaligen Standpunkt aus gesehen ein enormer geistiger Schritt: Denn als Komponist, der so gar nicht in das Schema der europäischen Musik hineinpasst, musste ihm von vornherein Erfolglosigkeit beschieden sein. Dass er sich dennoch zu solch einem Schritt durchringen konnte, könnte man als besondere Charakterstärke interpretieren.
Die weitgehende Abgeschiedenheit von der gesellschaftlichen wie von der künstlerischen Welt mit der trotzigen Behauptung der eigenen künstlerischen Ideale trägt heldenhafte Züge – und hat mit der tatsächlichen Realität des 20. Jahrhunderts wenig zu tun.
Man kann Thomas Mann dies als unschuldige Schwärmerei anrechnen, wenn man Stefan Zweigs Zeitbericht über die Wirkung der modernen Kunst vergegenwärtigt, die selbstverständlich nur im engsten Zusammenhang mit den rasenden gesellschaftlichen Veränderungen nach dem ersten Weltkrieg zu verstehen sind:
„Was Wunder, wenn da eine ganze junge Generation erbittert und verachtungsvoll auf ihre Väter blickte, die sich erst den Sieg hatten nehmen lassen und dann den Frieden? Die alles schlecht gemacht, nichts vorausgesehen und in allem falsch gerechnet? War es nicht verständlich, wenn jedwede Form des Respekts verschwand bei dem neuen Geschlecht? (…) Mit einem Ruck emanzipierte sich die Nachkriegsgeneration brutal von allem bisher Gültigen und wandte jedweder Tradition den Rücken zu, entschlossen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, weg von alten Vergangenheiten und mit einem Schwung in die Zukunft. (…) Jede Ausdrucksform des Daseins bemühte sich, radikal und revolutionär aufzutrumpfen, selbstverständlich auch die Kunst. Die Malerei erklärte alles, was Rembrandt, Holbein und Velasquez geschaffen, für abgetan und begann die wildesten kubistischen und surrealistischen Experimente. Überall wurde das verständliche Element verfemt, die Melodie in der Musik, die Ähnlichkeit im Portrait, die Faßlichkeit in der Sprache. (…) Die Musik suchte starrsinnig eine neue Tonalität und spaltete die Takte, die Architektur drehte die Häuser von innen nach außen (…). Auf allen Gebieten begann eine Epoche wildesten Experimentierens, die alles Gewesene, Gewordene, Geleistete mit einem einzigen hitzigen Sprung überholen wollte; je jünger einer war, je weniger er gelernt hatte, desto willkommener war er durch seine Unverbundenheit mit jeder Tradition – endlich tobte sich die große Rache der Jugend gegen unsere Elternwelt triumphierend aus.“3
Keine Spur von diesem ekstatischen Rausch in der Kunst ist bei Thomas Mann zu finden. Leverkühn „verschläft“ im Grunde genommen den kompletten ersten Weltkrieg inklusive aller Veränderungen, zurückgezogen in ein verschlafenes, bayerisches Nest namens Pfeiffering, das er sich als von der Welt abgeschiedenes Domizil erwählte. Thomas Mann strapazierte die tatsächliche Realität zugunsten seines Bildes vom modernen Komponisten, der durch sein Kalkül, der mathematischen, konzeptuellen Anlage seiner Werke, der Welt völlig fremd bleiben muss, insbesondere der politischen und in diese nicht aktiv durch seine Kunst eingreift.
Dass gerade Schönberg ein solch Zurückgezogener nicht war, wusste Thomas Mann natürlich nur zu genau, woraus sofort einleuchtet, dass er mit seiner Romanfigur Schönberg nicht einfach nur diffamieren, geschweige denn portraitieren wollte.
Der reale, in Wien ansässige Komponist scharte bald einen sektiererischen Kreis um sich, dem Vorbild Stefan Georges nachempfunden, nahm Anteil an den künstlerischen Entwicklungen, produzierte Skandale, schmiedete Ränke – kurzum er nahm lebhafter an den Tendenzen der Wiener Moderne Teil als es Thomas Mann lieb sein konnte. Die Aussage Nuria Schönbergs, ihr Vater habe die Zwölftonmusik nur für sich selbst erfunden zielt eigentlich fast schon ins Lächerliche. Denn im Gegensatz zum „stillen“ Adrian Leverkühn war Schönberg ein Komponist, der seine Neuerungen als absolute Wahrheit verstand und in seinen Kreisen mit eiserner Faust durchsetzte (man vergleiche etwa die Ausführungen in seiner Harmonielehre, oder das eifersüchtige Verhältnis zu seinen Schülern Berg und Webern), der sich in der Musikgeschichte auch deshalb einen Platz erringen konnte, weil er die Fähigkeit zum Aufmerksamkeit heischen, will sagen zum lauten Schreien, vorzüglich beherrschte. Wie sonst konnte der Komponist die sogenannte „zweite Wiener Schule“ etablieren, wie sonst konnte ein (im Grunde unbedeutender) Komponist wie Josef Hauer, der den Titel eines Erfinders der Zwölftonmusik gleichermaßen führen könnte, in Vergessenheit geraten? Doch zurück zur Romanfigur und dem Typus des modernen Komponisten, mit dem wir es ja vordergründig zu tun haben.
Am Ende des Buches legt Thomas Mann den großen, künftigen Konflikt der Neuen Musik in einer einzigen, großen schwärmerischen Phantasie dar, nämlich in der Beschreibung eines nicht existierenden Kunstwerkes, dem letzten Opus von Adrian Leverkühn: Das große Oratorium Dr. Fausti Weheklag. Die Problematik einer komplett durchorganisierten Musik wird im Buch schon im Vorfeld an verschiedenen Stellen immer wieder angedeutet. Die Kunst erscheint nicht erst in der Moderne als Waage zweier Gegensätze: Je mehr in die Waagschale der Konstruktion gelegt wird, umso stärker sinkt die Expressivität und umgekehrt. Nachdem sich Leverkühn immer stärker in die Konstruktion vergraben hat, lässt Mann an dem Komponisten einen wahrhaft genialen Zug in Erscheinung treten. Mit seinem letzten Werk ist es Adrian Leverkühn vergönnt, da er die komplexesten Konstruktionen so lange geübt und verinnerlicht hat, innerhalb der totalen Ordnung zu einer neuen, wahren Expressivität zu gelangen.
Die Sicht des Erzählers wird im Roman durch den drohenden Ausbruch des zweiten Weltkrieges gegen Ende des Romans, auch zu dieser musikalischen Schilderung hin, immer düsterer:
„Mein armer großer Freund! Wie oft habe ich, in dem Werk seines Nachlasses, seines Unterganges lesend, das so viel Untergang seherisch vorwegnimmt, der schmerzhaften Worte gedacht, die er beim Tode des Kindes zu mir sprach: des Wortes, es solle nicht sein, das Gute, die Freude, die Hoffnung, das solle nicht sein, es werde zurückgenommen, man müsse es zurücknehmen! Wie steht dieses Ach, es soll nicht sein, fast einer musikalischen Weisung und Vorschrift gleich, über den Chor- und Instrumentalsätzen von Dr. Fausti Weheklag, wie ist es in jedem Takt und Tonfall dieses Liedes an die Trauer beschlossen! Kein Zweifel, mit Blick auf Beethovens Neunte als ihr Gegenstück in des Wortes schwermütigster Bedeutung, ist es geschrieben.“
Eine letzte optimistische Option ließ Thomas Mann für die weitere musikalische Entwicklung offen: Nämlich trotz dem Verlust der Tonalität zu einer ausdrucksvollen musikalischen Sprache zu finden. Dass sich die deutsche Musikkultur sogar genau ins Gegenteil entwickeln sollte, konnte Thomas Mann beim besten Willen nicht ahnen. Die Darmstädter Schule, die bald nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland begründet wurde, forderte eine so vollkommene, totale Organisation in der Musik, dass die Ordnungsversuche Schönbergs und Weberns wie freie Improvisationen wirken.
Der schwache Glanz des Optimismus in einer zusammenstürzenden Welt sollte sich in einem anderen Teil der Welt aber doch noch bewahrheiten. Schostakowitsch verwendete beispielsweise in seiner 15. Symphonie (1971) zwölftönige Melodien, die so gekonnt und meisterhaft gesetzt sind, dass die Konstruktion beim Hören nicht auffällt, die vielmehr durch eine nahezu unheimliche Schönheit bestechen. Hier wird die milde Versöhnung zwischen dem empfindsamen Musiker und der starren Zwölftontechnik erreicht, was nur einem echten Genie gelingen kann.
Thomas Mann schwebt als Ausflucht der modernen Musik die Möglichkeit der Schönheit in derselben vor, wie sie beispielsweise Kant in seiner Kritik der Urteilskraft beschrieben hat:
„(…) schöne Kunst muß als Natur anzusehen sein, ob man sich ihrer zwar als Kunst bewußt ist. Als Natur aber erscheint ein Produkt der Kunst dadurch, daß zwar alle Pünktlichkeit in der Übereinkunft mit Regeln, nach denen allein das Produkt das werden kann, was es sein soll, angetroffen wird; aber ohne Peinlichkeit, ohne daß die Schulform durchblickt, d.i. ohne eine Spur zu zeigen, daß die Regel dem Künstler vor Augen geschwebt, und seinen Gemütskräften Fesseln angelegt habe.“4
Aus diesen Ausführungen kann man hoffentlich ersehen, wie viel künstlerische Ahnung Thomas Mann mit seinem Adrian Leverkühn bewiesen hat, um wie viel mehr er Schönberg und Adorno an Weitsichtigkeit in der Beurteilung der Moderne übertroffen hat.
Bisher wurde nur die künstlerische Seite des modernen Komponisten ausgeführt. Wie sieht es aber mit der sozialen und gesellschaftlichen Stellung aus? Auch hier kann man in Leverkühn das Sinnbild eines modernen Komponisten erfahren.
Zunächst ist da die unheimliche Kälte, mit der Adrian Leverkühn seiner Mitwelt begegnet. Eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit ist in seiner Gegenwart zu spüren, sei es in den weitschweifigen Diskussionen unter evangelischen Theologiestudenten, den Gesellschaftsabenden in München, in den Gesprächen und dem Umgang mit seinem Freund Zeitblom. Diese Kälte wird sogar bissige Realität im XXV. Kapitel, in dem Adrian seinem inneren Versucher leibhaftig gegenüber sitzt, der ihm mit seiner Kälte im sommerlichen Italien so zusetzt, dass Adrian genötigt ist, seinen Wintermantel aus dem Schrank zu holen.
Im folgenden Gespräch verspricht ihm sein „Mephistopheles“ ein bewegtes Leben mit rauschenden Höhen und Tiefen, undenkbaren Erfolgen, wenn er – der Liebe abschwört:
„Herwiderumb wollen wir dir unterweilen in allem untertänig und gehorsam sein, und dir soll die Hölle frommen, wenn du nur absagst allen, die da leben, allem himmlischen Heer und allen Menschen, denn das muß sein.“
Ich (äußerst kalt angeweht): „Wie? Das ist neu. Was will die Klausel sagen?“
Er: „Absage will sie sagen. Was sonst? Denkst du, Eifersucht ist nur in den Höhen zu Hause und nicht auch in den Tiefen? Und bist du, feine erschaffene Creatur, versprochen und verlobt. Du darfst nicht lieben.“
Das Liebesverbot in diesem Zusammenhang erweist sich wiederum als ein ganz erstaunlicher, ungewöhnlicher Einfall Manns. Mit der Faust-Sage an sich nicht verwandt, kennt man es eher aus Shakespeares Maß für Maß, oder Wagners Oper Rheingold, in der Alberich die Liebe verflucht, um mit dem Gold die höchste weltliche Macht zu erringen. Warum muss aber auch ein Komponist der Moderne die Liebe fliehen?
Was damit beschrieben wird, und das ist für diese Zeit, aber auch heute noch, eine verdrängte Tatsache von erheblicher Wichtigkeit: Ein Komponist, der sich ganz und gar dem totalitären Kontrollzwang ergibt, der seine innere Freiheit zu Gunsten einer durch nichts gerechtfertigten, brutalen, künstlerischen Ideologie opfert, muss auch seinem Inneren nach und nach Gewalt antun. Er versenkt sich durch seine Arbeit so sehr in ein konstruiertes System, dass er zur leidenschaftlichen künstlerischen Empfindung unfähig wird. Er ist der Warmherzigkeit nicht fähig, er ist ein Satiriker ersten Grades, der die Welt nur von oben herab, mit einem verachtenden Blick betrachtet. Alles „Gewesene, Gewordene, Geleistete“ verachtet er. Ein solcher Komponist überhebt sich aller Konventionen und lebt allein oder zusammen mit wenigen Gleichgesinnten in einem elitären Kreis, in dem man sich über die ganze Welt erhaben fühlt. In unserer Zeit wird dieser Menschenschlag am zutreffendsten vom deutschen Kompositionsprofessor verkörpert.
Auch die Wirkung dieser Kunst ist damit voll und ganz durchleuchtet: Nur satirische, gehässige, abschätzige oder bittere Stimmung kann in ihr zum Ausdruck kommen. Für die Palette positiver menschlicher Empfindungen ist kein Platz, von der Ideologie, aber auch von der Technik her gesehen. Dieses Liebesverbot, das Thomas Mann im XXV. Kapitel von Adrian Leverkühn abverlangt stellt ein Meisterstück intuitiver Erkenntnis dar. Menschlich wie künstlerisch beschreibt er in einer einzelnen Handlung, dem Pakt mit dem Teufel im verhängnisvollen Liebesverbot die Auswirkungen des künstlerischen Wahnsinns der Moderne, nämlich dem Untergang des Gefühls zugunsten absoluter Konstruktion.
Letztlich hatte Nuria Schönberg einen richtigen Ansatz, wenn sie Thomas Mann bezichtigt, sein Adrian Leverkühn verkörpere das Ende der deutschen Kultur. Ihr Blickwinkel war dabei nur auf Schönberg beschränkt, während Thomas Mann in Leverkühn den modernen Komponisten per se beschreibt. In einem tiefen Sinne hat er Recht behalten, was den Untergang der deutschen Kultur betrifft, den er persönlich, im Gegensatz zu uns miterlebt hat, und damit im vollen Bewusstsein darüber schrieb, was in Deutschland durch die Kriege vielleicht auf immer verloren gegangen ist.
Die Kunst ist der schillernd bunte Spiegel, in den der Mensch fortwährend durch alle Jahrtausende blickt. Nie und nimmer lässt sie sich auf eine eingeschränkte Palette der menschlichen Empfindungen reduzieren, vermittelt durch den Zwang bestimmter Techniken und Formen.
Künstler, die sich nur auf einen solchen Ausschnitt beschränken, empfinde ich persönlich als unvollkommener im Vergleich zu denjenigen, denen es gelang, die höchsten und tiefsten, die freudigsten und zerstörerischen, die ruhigen und aufbrausendsten Momente im Leben eines Menschen zu bannen und uns Zuhörern in einer Weise nahe zu führen, wie sie uns im Leben wohl kaum jemals mit solcher Intensität begegnen werden.5 Das ist die Magie und der Zauber der Kunst, den Thomas Mann mit seinem schwachen optimistischen Ausblick am Ende des Buches und letztendlich mit seiner ganzen literarischen Kunst auch in unsere moderne Zeit transportieren wollte – und scheiterte.
DICHTER. Geh hin und such dir einen andern Knecht!
Der Dichter sollte wohl das höchste Recht,
Das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt,
Um deinetwillen freventlich verscherzen!
Wodurch bewegt er alle Herzen?
Wodurch besiegt er jedes Element?
Ist es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt
Und in sein Herz die Welt zurücke schlingt?
Wenn die Natur des Fadens ewge Länge,
Gleichgültig drehend, auf die Spindel zwingt,
Wenn aller Wesen unharmonsche Menge
Verdrießlich durcheinander klingt:
Wer teilt die fließend immer gleiche Reihe
Belebend ab, daß sie sich rhythmisch regt?
Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe,
Wo es in herrlichen Akkorden schlägt?
Wer läßt den Sturm zu Leidenschaften wüten?
Das Abendrot im ernsten Sinne glühn?
Wer schüttet alle schönen Frühlingsblüten
Auf der Geliebten Pfade hin?
Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter
Zum Ehrenkranz Verdiensten aller Art?
Wer sichert den Olymp? vereinet Götter?
Des Menschen Kraft, im Dichter offenbart.
…
(Faust I)
- 1 http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/41281
- 2 Volkmar Klien: Neue Musik und die Verteidigung des Abendlandes, Contrapunkt Ausgabe Nr. 9, S. 8
- 3 Stefan Zweig, Die Welt von Gestern, insel taschenbuch, Berlin, 2013, S. 342ff.
- 4 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974, S. 241
- 5 Anm.: So steht etwa ein Schauspieler, der nur eine bestimmte Art Rollen spielen kann, in der Gunst des Publikums niedriger, als ein Schauspieler, der zu einer umfassenden Variabilität in seiner Charaktergestaltung fähig ist. Deshalb war Wilhelm Meister in Goethes Roman kein nachhaltiger Erfolg beschieden, da er ausschließlich den Hamlet, der seiner persönlichen Neigung zufälligerweise entsprach, überzeugend zu spielen vermochte.









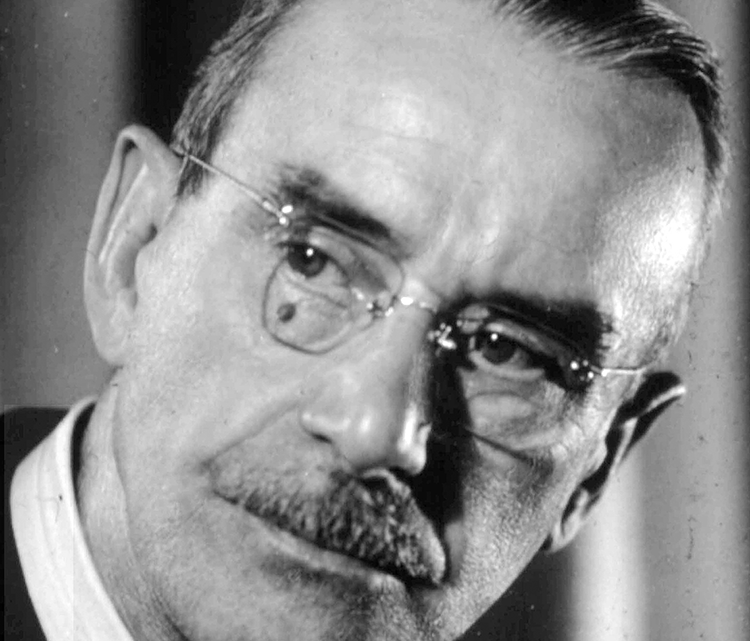


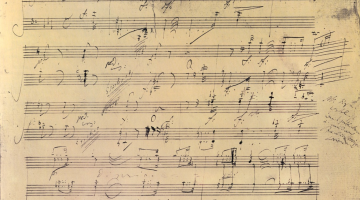
No Comment